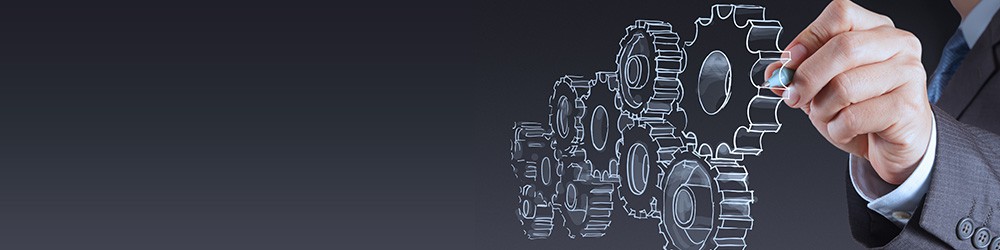
10.30 Uhr: Eintreffen und Registrierung
11.00 Uhr: Podiumsdiskussion / Offener Diskurs zwischen Politik und Wirtschaft
Johannes Remmel, Minister für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen,
Dr. Kai Zwicker, Landrat Kreis Borken,
Ingo Hoff, Unternehmervertreter, Stellv. Vorsitzender AIW Unternehmensverband "Aktive Unternehmer im Westmünsterland e.V."
Tobias Heidemann (Moderation)
11.30 - 12.00 Uhr: Zeit für einen Rundgang durch die Infolandschaft
anschliessend 16 spannende Vorträge, Kommunikation und Austausch (Hörsäle 1 - 4)
16.15 - 17.00 Uhr: Zeit für einen Rundgang durch die Infolandschaft und Büfett
17.00 - 18.00 Uhr: Resümee und Improvisationstheater
Eine Übersicht können Sie sich hier in Form des aktuellen Faltblattes herunterladen ...
Johannes Remmel (Minister für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen)
Dr. Zwicker (Landrat Kreis Borken)
Ingo Hoff (Unternehmervertreter Stellv. Vorsitzender AIW Unternehmensverband “Aktive Unternehmen im Westmünsterland e.V.")
Tobias Heidemann (Moderation)
Aufgrund steigender Strompreise und damit auch steigenden Anteilen der Energiekosten an den Gesamtkosten von Gewerbebetrieben rücken Eigenerzeugung und Energieeffizienzmaßnahmen immer stärker in den Fokus des Betrachters. Gleichzeitig nimmt auch das Umweltbewusstsein zu. Mehr Energie aus der Kilowattstunde Strom zu nutzen hat dadurch neben der Motivation zur Kostenoptimierung auch Beweggründe des effizienten Ressourceneinsatzes. Daneben können im Bereich der Mobilität Kosten und CO2-Emissionen mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen gesenkt werden. An der Stelle kann der Eigenverbrauch vor Ort durch den gezielten Einsatz von Komponenten wie z. B. Speichertechnologien, Ladeinfrastruktur und Lastmanagement ergänzt bzw. erhöht werden. Die Hauptherausforderung ist hierbei die wirtschaftliche und technische Integration der Systeme in einen bestehenden Betrieb. Die P3 Group betrachtet in diesem Rahmen welche Komponenten bereits die Marktreife erreicht haben, welche Komponenten mit einem positiven Business Case eingesetzt werden können und welche Synergien sich aus der Integration zu einem Gesamtsystem ergeben.
Benjamin Hörpel (P3 Energy & Storage GmbH, Deutschland)
Zur Herstellung von Formteilen aus Kunststoff werden geschäumte Polypropylen-Kugeln mit Wasserdampf unter Druck verschweißt. Der Dampf wurde in 2 mit Erdgas betriebenen Dampfkesseln aus enthärtetem Trinkwasser erzeugt. Nach einer Grundlagenermittlung zur Erfassung der Prozesse und der Stoff- und Energieströme, wurde ein Konzept erstellt und verschiedene Maßnahmen zu Verringerung des Wasser- und Erdgasverbrauches vorgeschlagen und realisiert. Der Wasserverbrauch (und damit auch die Abwassermenge) konnte durch Recycling von überschüssigem Kühlwasser um ca. 30.000 m³/Jahr vermindert werden. Durch Nutzung von Brunnenwasser konnte außerdem der Trinkwasserbezug um weitere 57.000 m³/Jahr gesenkt werden. Hieraus ergeben sich für den Kunden Einsparungen von ca. 100.000,- Euro/Jahr beim Trinkwasser und ca. 60.000,- Euro/Jahr beim Abwasser. Das Mischwasser aus gefiltertem Kühlwasser, Brunnenwasser und Trinkwasser wird durch eine Umkehrosmoseanlage entsalzt und mittels Wärmetauscher unter Ausnutzung von vorhandener Abwärme von ca. 15 °C auf ca. 70 - 80 °C vorgewärmt. Hierdurch konnten ca. 5.000 MWh/Jahr bzw. ca. 180.000,- Euro/Jahr an Erdgas eingespart werden. Bei einer Investitionssume von ca. 400.000,- Euro konnte der Kunde insgesamt ca. 340.000,- Euro/Jahr einsparen.
PDF-Datei zum Vortrag herunterladenSven Kalbertodt (Weil Wasseraufbereitung GmbH)
Umweltgerechte Produktentwicklung ist aus vielen Gründen sinnvoll. Die ideellen, volkswirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Gründe sind hinreichend bekannt. Es gibt aber eine ganze Handvoll handfester ökonomischer Gründe, warum sich dieses Thema für viele produzierende Unternehmen als zukunftssicherer Innovationstreiber anbietet. Dabei geht es um knallharte Faktoren: Ressourceneinkauf, SupplyChains, Investitionen, Vertriebsstrukturen, etc. Wir beleuchten gemeinsam den Einfluss von Produktdesign auf die Entwicklung neuer Produkte und Sortimente und erarbeiten exemplarisch Herangehensweisen für eine erfolgreiche und nachhaltige Produktion von morgen. Einbezogen werden Aspekte aus Produktion, Logistik, Vertrieb, Handel und Marketing.
PDF-Datei zum Vortrag herunterladenOliver Francke (GENERATIONDESIGN GmbH)
"Energie & CO2-arme Wirtschaft" ist einer der Schwerpunkte des aktuellen INTERREG V - Programms der EUREGIO. Auch kleine und mittlere Unternehmen der Region können von dieser Europäischen Strukturförderung profitieren.
Eine Möglichkeit ist die Teilnahme am Netzwerk GEP - Grenzenloses Effizientes Produzieren. Hier kooperieren Betriebe aus den Niederlanden, Niedersachsen und NRW um ganzheitliche Produkt- und Prozessinnovationen auf den Weg zu bringen, Leitmärkte zu erschließen und den notwendigen Wissenstransfer sicherzustellen. Das Netzwerk richtet sich an Unternehmen, die die Effizienz Ihrer Prozessabläufe steigern und dabei Ihren Energieverbauch und CO2-Ausstoß nachhaltig reduzieren wollen.
Thomas Melchert (Handwerkskammer Münster)
Die ab 01. Januar 2015 gültige neue F-Gase Verordnung (EU-VO 517/2014) stellt Betreiber von Kälte- und Klimaanlagen (einschließlich Wärmepumpen) mit sogenannten F-Gasen vor große Herausforderungen. Die EU-Verordnung 517/2014 sieht eine schrittweise Reduktion der H-FKW-Mengen sowie zukünftige Verwendungs- und Vermarktungsbeschränkungen von
F-Gasen mit hohem GWP vor. Daher stellt sich für Betreiber und Fachunternehmen die Frage:
Welches Kältemittel kann ich zukünftig und auch langfristig einsetzen bzw. empfehlen?
Von der Kühlung einzelner Produkte, über die Erzeugung von Kälte in Räumen bis hin zur Kühlung von Systemen (z.B. Maschinen, Motoren), sind die Einsatzgebiete der Kältetechnik sehr unterschiedlich. Aus diesem Grund werden innovative Kälteanlagen mit individuell konzipierten Lösungen benötigt. So wird in der Industriekälte seit Jahrzehnten Ammoniak eingesetzt. Im Tiefkühlbereich bietet sich bei höheren Leistungen der Einsatz von CO2-Kaskaden an.
In der Klein- und Gewerbekälte hingegen ist der Einsatz von H-FKW noch Standard. Nicht nur aufgrund gesetzlicher Änderungen ist hier ein Umdenken erforderlich - Aspekte wie Energieeffizienz und ökologische Nachhaltigkeit sollten die Basis beim Betrieb einer jeden Kühlung sein.
Dieser Fachvortrag gibt Ihnen zunächst einen kurzen Überblick über die aktuelle Gesetzeslage und zeigt Ihnen darauf aufbauend zukunftsweisende Lösungen in der Kälte- und Klimatechnik. Es werden heutige Einsatzmöglichkeiten natürlicher Kältemittel sowie Anlagenkonzepte, die ganz auf Kältemittel verzichten diskutiert.
Jürgen Willing (Tekloth GmbH)
Unentdeckte Leckagen gibt es nicht nur in der Lebensmittelherstellung. Wie diese aufgespürt und dauerhaft beseitigt werden können zeigt ein Praxisbeispiel.
Wasser-intensive Arbeitsabläufe, wie Spülen und Reinigen weisen enorme Optimierungspotenziale auf. Wie der damit einhergehende Wasserverbrauch reduziert werden kann zeigt ein weiteres Beipiel.
Solche Praxislösungen sind mögliche Ergebnisse eines PIUS-Checks. Entscheidende Arbeitshilfe beim PIUS-Check ist die Aufstellung einer Massenbilanz und eines Grundfließbildes mit Herkunftsbereichen und Prozessanalysen. Hierdurch offenbaren sich häufig eine oder mehrere Schwachstellen, die nicht zum Kernprozess gehören - denn die kennt der Betriebsleiter - sondern Arbeiten am Rande, ggf. auch von Drittfirmen - hier hilft die "nicht vorhandene Betriebsblindheit". Das Ergebnis eines solchen PIUS-Checks sind Potenzialidentifikation und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen als Entscheidungshilfe bei notwendigen Investitionen. Eine Einsparmaßnahme oder Prozessveränderung ist nur so gut wie ihre monetäre Wirkung im Betrieb. Eine Kostenberechnung mit allen Rand- und Nebenkosten hilft dem Betrieb, die wesentlichen von den unwesentlichen Maßnahmen zu unterscheiden und motiviert die Geschäftleitung zu investieren, wenn die Amortisationsdauer das gesetzte Limit sicher unterschreitet.
Am Ende hängt aber doch jeder Erfolg von der Umsetzung ab. Selbst hier bestehen noch Alternativen: "make or buy - contracting in kurzen Worten" Eine Kurzfassung des Contracting-Leitfadens wird vorgestellt, der es dem Betrieb ermöglicht, zu bewerten, ob eine Aufgabe, die nicht zum Kerngeschäft gehört (z.B. Betreib einer Kläranlage, einer Kältemaschine, eines Kesselhauses etc.), selbst ausgeführt oder von einem Dritten (wissend um dessen Gewinnmarge) die Tätigkeit übernommen wird, weil dieser durch sein know-how deutlich mehr erwirtschaftet als die oben erwähnte Marge.
Claus Bohling & Dipl.-Ing. Holger Mlasko (Industrieberatung Umwelt GmbH & Co. KG)
Eine entscheidende Frage für Gesellschaft und Wirtschaft ist der Umgang mit begrenzten Ressourcen. Ein denkbarer Weg ist die kontinuierliche Senkung von Verbräuchen bzw. von Inputs in technisch-wirtschaftlichen Anwendungen. Allerdings ist das Potenzial von effizienzsteigernden Maßnahmen technisch-physikalisch begrenzt und führt unweigerlich als Inputbegrenzung zum Ende wirtschaftlichen Wachstums.
Die Natur zeigt uns, dass es anders geht: sie kennt keine Stoffe in ihren Kreisläufen, die nicht verwertbar sind. Wachstum wird nicht begrenzt, sondern dort wo Stoffkreisläufe stabil funktionieren, gefördert: das Bessere im Sinne von Effizienz und Effektivität setzt sich durch.
Diese Logik geschlossener Kreisläufe in industriellen Prozessen umzusetzen, ist das Ziel von Cradle-to-Cradle (von der Wiege zur Wiege). Voraussetzung dafür sind Produkte, die sich in der immer gleichen Qualität recyceln lassen, und Prozesse, die frei von Abfall- bzw. nicht wiederverwertbaren Stoffen sind.
So entsteht aus einer linearen Herstellung, die am Ende Entsorgung bedeutet, eine Kreislaufwirtschaft, die Ressourceneffizienz mit Ressourceneffektivität für mehr Wachstum von nachhaltiger Produktion und Produkten verbindet.
Zukunftsfähige Geschäftsmodelle zu gestalten heißt im Zweifel in diesem Sinne Produkte und Prozesse neu zu (über-)denken. Der Vortrag zeigt anhand von praktischen Beispielen aus der Industrie, wie Effizienz und Effektivität miteinander verbunden werden können bzw. müssen und wie Cradle-to-Cradle kompatible Produkte und Prozesse aufgebaut und zertifiziert werden.
Lars Baumgürtel (Voigt & Schweitzer GmbH & Co. KG)
Klima- und Umweltschutz sind derzeit in aller Munde. Sowohl die Bundes- als auch die Landesregierung haben sich für die nächsten Jahre ehrgeizige Klimaschutzziele gesetzt. Für die Erreichung dieser Ziele werden den mittelständischen Unternehmen eine Vielzahl an Fördermöglichkeiten angeboten. Doch welches Förderprogramm eignet sich für das jeweilige betriebliche Vorhaben? Wie hoch ist der bürokratische Aufwand bei der Antragstellung? Und steht dieser überhaupt in einem angemessenem Verhältnis zu dem Förderbetrag? Der Vortrag gibt Antworten auf diese Fragen und zeigt anhand von praktischen Unternehmensbeispielen auf, wie vielfältig Förderprogramme helfen können, unternehmerische Entscheidungen in Sachen Klima- und Umweltschutz umzusetzen.
PDF-Datei zum Vortrag herunterladenIngo Trawinski & Torsten Schmalbrock (WFG für den Kreis Borken mbH & NRW.BANK)
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), also die gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme und die Nutzung beider Energien Vorort, kann für Unternehmen eine wirtschaftliche Alternative zur üblichen Strom- und Wärmeversorgung sein. Der Vortrag stellt die verfügbaren Technologien vor, beschreibt sinnvolle Einsatzgebiete, informiert beispielhaft über die für die Planung notwendigen Daten und gibt Informationen über flankierende Fördermittel.
PDF-Datei zum Vortrag herunterladenPeter Lückerath (EnergieAgentur.NRW)
Christian Lehmann (Muckenhaupt & Nusselt GmH & Co. KG)
Das härteste Wettbewerbsumfeld ist die Natur. Ein hoher Selektionsdruck führt dort zu Organismen, die mit geringem Aufwand besser an die herrschenden Bedingungen angepasst sind, als die Wettbewerber. Die hierzu verwendeten Strategien zum Materialeinsatz sind sehr effizient und als Strukturoptimierung abstrahiert auch in der Technik anwendbar. In diesem Vortrag werden Optimierungsmethoden und Vorgehensweisen für einen effizienten Materialverbrauch vorgestellt und diskutiert.
PDF-Datei zum Vortrag herunterladenProf. Dr.-Ing. Alexander Sauer (Westfälische Hochschule Bocholt)
"Die Bundesregierung hat sich mit ihren Beschlüssen vom 28. September 2010 und 6. Juni 2011 ambitionierte Ziele zur Erhöhung der Energieeffizienz gesetzt. Um diese Ziele zu erreichen, hat sie einen Energieeffizienzfonds zur Förderung der rationellen und sparsamen Energieverwendung aufgelegt, auf dessen Grundlage unter anderem die Förderung hocheffizienter Querschnittstechnologien in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und im „deutschen Mittelstand“ vorgesehen ist. Damit sollen die bestehenden Einsparpotentiale erschlossen und Ressourcen eingespart werden. Das BAFA bietet interessante Fördermöglichkeiten für kleine und mittelständische Unternehmen, die Investitionen in hocheffiziente Technologien vornehmen und damit nachhaltig für sparsame und rationelle Energieverwendung in ihrem Betrieb sorgen."
PDF-Datei zum Vortrag herunterladenTim Oliver Clös (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAFA)
Gerade in Gewerbegebieten sind besonders in Betrieben, die Prozesswärme benötigen,
hohe Abwärmepotenziale vorhanden, die ungenutzt an die Umgebung abgegeben werden.
Die effiziente Energienutzung ist eine Chance für Unternehmen und kann
Wettbewerbsvorteile sichern. Oftmals ist hierzu ein Blick über die Unternehmensgrenze
hinaus notwendig, um gemeinsam diese ungenutzten Potenziale nutzen zu können.
Am Beispiel „Energieoptimiertes Gewerbegebiet Vreden-Gaxel“ werden die Projektbeteiligten
des Beratungsunternehmens infas enermetric die Möglichkeiten vorstellen und über die
Erfahrungen in der Zusammenarbeit, auch im Hinblick auf Hemmnisse der Unternehmer
berichten.
Reiner Tippkötter & Michael Gebhardt (infas enermetric Consulting GmbH)
Die Steigerung der Produktivität sind die Grundlage unternehmerischen Erfolgs und die Basis für ressourceneffizientes Wirtschaften. Produktivität steigern bedeutet, die richtigen hierzu notwendigen Herausforderungen anzugehen (Effektivität) und die die definierten Aufgaben zielorientiert umsetzen (Effizienz). Der Vortrag zeigt anhand eines Best-Practise-Projektes, wie die Prozesstransparenz durch die Umsetzung einer Ressourcenkostenrechnung RKR® gesteigert wurde und die gewonnen Einsichten zur Steigerung der Effektivität und Effizienz und somit der Produktivität im Beispielunternehmen genutzt wurden.
Andre Döring (reQuire consultants GmbH)
Kennzahlen über die eigenen CO2-Emissionen werden für den produzierenden Mittelstand immer wichtiger – ob unter dem Aspekt der Ressourcen- und Kosteneinsparung oder der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen.
Mit dem Eco-Cockpit-Tool der Effizienz-Agentur NRW können Unternehmen die CO2-Emissionen ihrer Produkte, Prozesse aber auch ihres gesamten Standorts mit vertretbarem Aufwand ermitteln. Zum einen fragen heutzutage immer mehr Kunden die verbrauchten CO2-Mengen von Teil- und Fertigprodunkten nach. Zum anderen liefern die ermittelten CO2-Werte solide Grundlagen für Handlungsbedarfe, so dass konkrete Maßnahmen zur CO2-Minderung entwickelt werden können.
Die Datengrundlage für die Bilanzierung der CO2-Emissionen von Unternehmen bilden die freien Datenbanken ProBas (Umweltbundesamt) und Gemis (IINAS). Die Bilanzierungsmethode berücksichtigt die Anforderungen des Greenhouse Gas Protocols und die Ergebnisse werden als CO2-Äquivalente ausgegeben.
Der Vortrag basiert auf Erfahrungen aus bisherigen Eco-Cockpit Projekten mit Unternehmen aus NRW und zeigt neben Anwendungsmöglichkeiten auch den weiteren Nutzen für Unternehmen auf, sich mit der Thematik CO2-Bilanzierung auseinander zu setzen.
Neben der CO2-Bilanzierung ist das Managen der Emissionen ein bedeutender Schritt zum strategischen, nachhaltigen Wirtschaften und eine logische Weiterentwicklung von Energiemanagementsystemen.
Die EnergieAgentur.NRW unterstützt mit ihrem Pilotprojekt CCF.NRW Unternehmen bei der Erhebung des individuellen CO2-Fußabdrucks (Corporate Carbon Footprint). Zielgruppe des Projekts sind führende, vorausschauende Industrieunternehmen, die neben der Verbesserung ihrer Energieeffizienz auch die Emissionen ihrer Klimagase erfassen und kontrollieren wollen. Günstige Voraussetzung bietet dabei eine Zertifizierung gemäß DIN EN ISO 50001. Idealerweise baut die Erfassung des CCF auf bestehende "Plan-Do-Check-Act" Zyklen und vorhandene dokumentierte Energiedaten im Unternehmen auf. Zwingend notwendig sind diese Bausteine aber nicht.
Die EA.NRW arbeitet dabei im Pilotprojekt CCF.NRW praxisorientiert, modular und bietet klare internetbasierte Handlungsanweisungen.
Ina Twardowski & Frederik Pöschel (EnergieAgentur.NRW & Effizienz-Agentur NRW)
Der Vortrag erläutert, wie durch maßgeschneiderte Beratungsprojekte Ressourcenpotenziale in Industrie und Handwerk identifiziert und quantifiziert werden können. Ferner wird ein Überblick gegeben, wie diese Beratungsvorhaben mit öffentlichen Mitteln gefördert werden können. Die Angebote der Effizienz-Agentur NRW zur Unterstützung von Unternehmen bei der Entwicklung und Finanzierung von Beratungsprojekten werden auch dargestellt.
PDF-Datei zum Vortrag herunterladenAndreas Kunsleben (Effizienz-Agentur NRW)
© Copyright 2013-2026 - Effizienz Forum Wirtschaft - empathie concept agentur - Kontakt - Impressum - Datenschutz